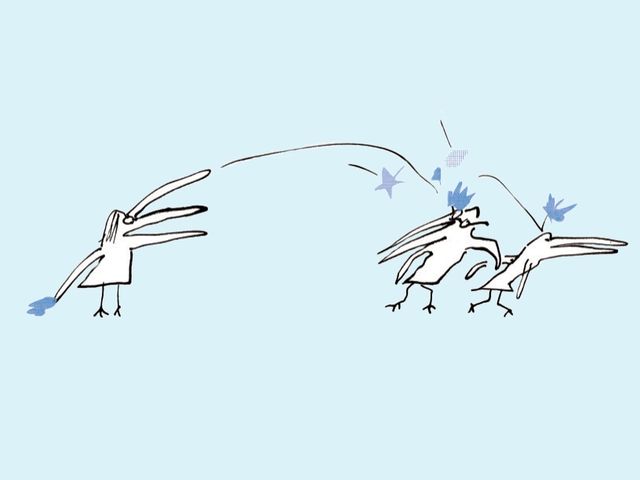Traurig oder komisch? Obwohl die Krankenkassen zurzeit Milliardenüberschüsse erwirtschaften, sind Ärzte in den Kliniken zum Sparen verdammt.
Jeden Tag bekommt der Betriebsrat der Uniklinik Marburg eine Überlastungsanzeige. Jeden Tag gesteht einer der 9500 Mitarbeiter ein: Ich kann nicht mehr. Folgen hatte das bisher nur, als öffentlich bekannt wurde, dass auch die Oberärzte der Kinderonkologie die Überlastung beklagten. »Da war das Geschrei groß«, sagt die Betriebsrätin Bettina Böttcher. »Alle hatten Angst um die Kinder.« Die Klinikleitung schuf daraufhin ein paar neue Stellen. In der Regel werden die Hilfeschreie überhört und die Mitarbeiter flüchten sich in Zynismus. Sie haben ihr eigenes Vokabular entwickelt, um die Zustände im Universitätsklinikum Gießen und Marburg zu beschreiben, das 2006 von der Rhön AG übernommen und als erste Uniklinik in Deutschland privatisiert wurde. Drei-Punkt-Pflege lautet einer der Begriffe. Klingt nach umfassender, individueller Versorgung der Kranken. Meint aber »je einen Tropfen Wasser mit dem Waschlappen unter die Achseln und einen untenrum«, sagt Ulrike Kretschmann, eine Hausärztin mit eigener Praxis in Marburg. Oder Intermediate Care: Hört sich nach einem ausgeklügelten Konzept für die Pflege an. Bedeutet aber, dass »sich die Schwester entscheiden muss, zu welchem Patient sie im Notfall als Erstes geht und wer auf der Strecke bleibt«.
Kretschmann hat mit anderen niedergelassenen Ärzten den »Notruf 113« gegründet, der gegen den Klinikalltag in Marburg protestiert. Über Jahre wurde dort die Arbeit verdichtet, mit dem Resultat, dass »heute einer wegschuftet, was früher zwei gemacht haben«, sagt die Betriebsrätin Böttcher. Krankenschwestern kritisieren, in der Hektik des Alltags könne es zu fatalen Fehlern kommen: Dann würden Infusionen zu spät abgestellt, Verbände nicht erneuert oder gar die Medikamente für verschiedene Patienten verwechselt. Es sieht nicht danach aus, als hätten Patienten und Personal in Marburg in naher Zukunft Besserung zu erwarten. Gerade läuft ein weiteres Rationalisierungsprogramm, 500 der 9500 Stellen sollen am Ende wegfallen. Und im Mai wurde bekannt, dass die Rhön AG vom Gesundheitskonzern
Fresenius, der bereits 75 Krankenhäuser betreibt, übernommen wird. Die nächste Sparwelle in Marburg - nur eine Frage der Zeit.
Nachhaltig wirtschaften mussten Krankenhäuser schon immer. Doch inzwischen haben Stellenkürzungen und Arbeitsverdichtungen ein Ausmaß erreicht, das die gesamte medizinische Versorgung in Deutschland zu ruinieren droht. Es ist nicht allein die Privatisierung der Medizin, die Patienten gefährdet. Auch in kommunal oder konfessionell geführten Krankenhäusern und in den Praxen macht es die Industrialisierung der Medizin Ärzten wie Pflegekräften schwer, das Wohl der Patienten noch im Auge zu behalten. Vor allem geht in dem ständig steigenden Arbeitsdruck etwas verloren, was wesentlich wäre für eine gute Medizin: Zeit für Zuwendung, Zuhören, Trost. Der Patient steht nicht mehr im Mittelpunkt, sondern wird zum Störfaktor.
Die ökonomisierte Medizin gleicht dieses Problem mit Technik aus: »Kann ein Patient im Krankenhaus nicht mehr genug trinken, bekommt er einen Tropf. Isst er zu wenig oder zu langsam, wird eine Magensonde gelegt. Nässt er ein, wird ein Dauerkatheter gelegt. Verhält er sich unruhig, werden Bettgestelle oder Fixierungen angebracht.« So beschreibt der Marburger Oberarzt Konrad Görg einen Krankenhausalltag, aus dem Fürsorge, Mitgefühl und Menschlichkeit wegrationalisiert wurden.
Der Fehler liegt im System, das sich auch dadurch auszeichnet, dass kaufmännische Direktoren die Ärzte an den Kliniken darüber belehren, welche Therapien lukrativ sind und welche eine Minusgeschäft. Wirtschaftlich günstig: zum Beispiel ein Patient mit Lungenkrebs. Er braucht alle drei bis vier Wochen eine Chemotherapie, für jeden dieser Aufenthalte von zwei bis drei Tagen kann die Klinik 2000 Euro abrechnen - zusätzlich bekommt sie Geld für die Chemotherapie. Ein Minusgeschäft: die Behandlung eines älteren Dialyse-Patienten mit chronischer Wunde am Fuß und Lungenentzündung. Er muss im Zweibettzimmer isoliert werden, ein Bett bleibt leer. Bei allen Untersuchungen muss anschließend der Raum desinfiziert werden. Die stationäre Behandlung kann schnell länger als zehn Tage dauern, dafür sind die 3500 Euro, die das Krankenhaus bekommt, keinesfalls kostendeckend.
Diese pauschale Honorierung je nach Diagnose bringt viele Kliniken in Bedrängnis. Bis vor wenigen Jahren wurde nach Liegedauer bezahlt. Das führte zwar zum Missbrauch, Patienten wurden oft unnötig übers Wochenende einbehalten. Aber wenigstens waren sie dann gesund. Die neue Bezahlung nach Krankheiten führt dazu, dass komplizierte Fälle abgeschoben werden - und im Extremfall »blutig entlassen«: Patienten müssen die Klinik verlassen, obwohl Wunden noch nicht verheilt, Drainagen nicht gezogen sind.
(Foto: Kirsty Griffin)
»Machen Sie halt mehr Schlaganfälle und weniger MS«

Insbesondere die Chefärzte müssen sich von ihren Controllern anhören, was sie zu tun und zu lassen haben. Laut Deutschem Ärzteblatt bekommen mindestens 45 Prozent der leitenden Mediziner Vorgaben, welche Operationen oder Behandlungen von ihnen erwartet werden - und einen Bonus, wenn sie das Soll erfüllen. »Machen Sie halt mehr Schlaganfälle und weniger MS«, bekam ein Neurologe vom Geschäftsführer zu hören. Patienten mit Schlaganfall in einer spezialisierten Abteilung zu behandeln ist lukrativ. Die Betreuung von MS-Patienten dagegen bringt neurologischen Kliniken wenig. Auch hier gilt: Technischer oder operativer Aufwand lohnen sich, intensive Betreuung durch hochqualifiziertes Personal nicht.
Weil sich Kliniken nach ökonomischen Erwägungen Patienten aussuchen, drohen ähnliche Szenarien wie bei einer privatisierten Bahn. So wie unrentable Bahnstrecken und Bahnhöfe stillgelegt werden, gibt es auch Krankheiten, die in einem immer weiter optimierten System nicht mehr behandelt werden.
Niedergelassenen Ärzten außerhalb des Klinikbetriebs ergeht es kaum besser. Wird etwa eine Kassenpatientin mit Brustkrebs behandelt, muss ein Frauenarzt viel Idealismus mitbringen, um gute Medizin zu betreiben. Das würde nämlich bedeuten, den Ängsten der Patientin zu begegnen, die Therapie zu erläutern, Perspektiven für den Krankheitsverlauf zu eröffnen. Diese zeitintensive Tätigkeit wird schlechter honoriert als ein Reifenwechsel an der Tankstelle: Pro Quartal kann ein Frauenarzt 15 bis 35 Euro pro Patientin für solche Gespräche bei der Krankenkasse abrechnen.
Das Spardiktat im Gesundheitssystem gründet letztlich auf zwei Halbwahrheiten: Die Menschen werden immer älter, die Medizin wird immer besser - und beides kostet Geld. Tatsächlich fallen bei den meisten Menschen 80 bis 90 Prozent der Gesundheitskosten im letzten Jahr vor ihrem Tod an. Sterben sie im Alter von 90 Jahren, ist es sogar billiger, als wenn sie mit 50 Jahren sterben, denn bei jüngeren Patienten unternimmt die Medizin größere Anstrengungen, um sie am Leben zu erhalten. Wahr ist also: Die Lebenserwartung steigt pro Jahr um drei Monate. Aber das erklärt nicht die Kostenexplosion im Gesundheitswesen.
Und der angebliche Fortschritt in der Medizin? Neue Untersuchungs- oder Behandlungsformen sind oft nur teurer, aber weniger geprüft und daher nicht besser als bewährte Methoden. Längst ist das Krankenhaus zum Warenhaus geworden, mit ständig neuem Sortiment. Grotesker Hintergrund: In der Klinik wird jede Behandlung erstattet, solange nicht erwiesen ist, dass sie dem Patienten schadet. Ein Nutzen muss nicht belegt sein. Der Hausarzt in der Praxis dagegen darf nur Methoden anwenden, die dem Patienten auch nachweislich nutzen. Zum Beispiel wird eine besondere Form der Bestrahlung bei Prostatakrebs im Krankenhaus erstattet, in der Arztpraxis nicht. Das Gleiche gilt für die Vakuumtherapie bei Neurodermitis. Würden die Kassen auch in den Krankenhäusern nur bezahlen, was Patienten erwiesenermaßen nutzt, wären enorme Einsparungen die Folge – und die Kranken besser versorgt. Im Moment können viele Kliniken nur existieren, weil sie in großem Stil fragwürdige Untersuchungen und Therapien anwenden.
Auch auf dem Arzneimittelmarkt hält sich der Fortschritt in Grenzen: Neuerungen der letzten Dekade betreffen vor allem Nachahmerprodukte, der Anteil der tatsächlichen Innovationen hat sich seit den Neunzigerjahren halbiert, das haben Dutzende Studien und Kommissionen festgestellt. Neue Medikamente zur Behandlung großer Patientengruppen - wie Antidepressiva, Blutdrucksenker, Psychophar-maka und Cholesterinsenker - sind meist drei- oder gar zehnmal so teuer wie ihre Vorgänger. Aber sie wirken nicht besser, sondern verursachen nur mehr Nebenwirkungen. Trotzdem knickten alle Gesundheitsminister der letzten 15 Jahre - ob Horst Seehofer, Ulla Schmidt oder Daniel Bahr - ein, als es darum ging, eine »Positivliste« für bewährte, notwendige Medikamente einzuführen. Nur diese Medikamente sollten die Krankenkassen übernehmen - das war die Idee. Doch immer wieder drohte die Lobby der Pharmahersteller, ihre Produktion dann ins Ausland zu verlagern und Tausende Arbeitsplätze zu streichen. Deshalb dürfen in Deutschland heute 60 000 Präparate verschrieben werden, obwohl nur 1500 für eine umfassende Versorgung unverzichtbar sind.
»Leider wollen viele Patienten nicht wahrhaben, dass weniger oft mehr wäre«, bedauert Jürgen Windeler, der das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Medizin leitet und bei der Erstellung der Positivliste mitwirkte. »Sie fürchten, dass man ihnen etwas wegnimmt und sie weniger Wahlmöglichkeiten haben – unabhängig davon, ob ein Nutzen erwiesen ist oder nicht.«
Beispiel Rückenschmerzen, Volksleiden Nummer eins. Keine andere Krankheit verursacht mehr Arbeitsausfälle und Frühverrentungen. Doch in kaum einem Bereich der Medizin existiert eine größere Diskrepanz zwischen Befund und Befinden: In Röntgen-, CT- und Kernspin-Untersuchungen sieht der Experte zwar bei den meisten Menschen starke Abnutzungen - aber der Verschleiß sagt wenig darüber aus, ob jemand tatsächlich Rückenbeschwerden hat. Im Rahmen einer Studie wurden Radiologen und Orthopäden Hunderte Röntgenbilder und CT-Aufnahmen gezeigt. Etwa bei jedem dritten Fall erkannten die Mediziner krankhafte Prozesse und rieten zur Operation. Was die Knochenexperten nicht wussten: Man hatte ihnen Aufnahmen von beschwerdefreien Probanden vorgelegt. Fast die Hälfte aller 50-Jährigen hat sogar einen Bandscheibenvorfall und merkt nichts davon, wie die Untersuchung ergab.
»Überdiagnostik« und »Übertherapie«

Beispiel Herzkatheter. Eine Stadt der Größe Münchens verfügt über fast 20 Großpraxen, Kliniken und medizinische Zentren, die Patienten genau auf Herzbeschwerden untersuchen können. Mit Hilfe von Herzkathetern färben Kardiologen Blutgefäße an und entdecken mögliche Engstellen, die auf einen drohenden Infarkt hinweisen. Etwa 1000 Euro Honorar bringt die Prozedur, die Zahl der Untersuchungen steigt rasant, in Deutschland werden heute mehr als 880 000 Patienten pro Jahr mit Herzkathetern inspiziert. Viel zu viele, bemängeln Experten. Häufig hätten Patienten keinerlei Nutzen, dafür aber Nebenwirkungen und Nachteile des Eingriffs zu ertragen. In einer Analyse aus dem Jahr 2010 zeigte sich, dass in den USA nur 37 Prozent derer, bei denen die aufwendige und teure Prozedur vorgenommen wurde, tatsächlich verengte Kranzgefäße aufwiesen. Studien in Deutschland kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Daraus folgt: Für die 1,3 Millionen Einwohner von München würden drei bis fünf Herzkatheter-Labore reichen - mit dem angenehmen Effekt, dass die behandelnden Ärzte dann auch genug Erfahrung und Übung mit dem Eingriff hätten.
Doch Vernunft und Verzicht ist nicht vorgesehen im ökonomisierten Gesundheitssystem, die Kliniken und Konzerne streben nach Wachstum, deshalb schafft sich die Medizin einen Teil ihrer Nachfrage gleich selbst: Unter den Schlagwörtern »Screening« und »Risikominimierung« werden Gesunde vorbeugend untersucht und behandelt. Die Konsequenz: immer mehr Gesunde mit Befunden ohne Bedeutung - und viele Kranke ohne Befund.
Dabei kann es aus medizinischer Sicht sinnvoller sein, abzuwarten statt die Kranken gleich mit Tests und Pillen zu traktieren. Aber weil Ärzte nicht für Zurückhaltung honoriert werden, kommt es in der modernen Medizin zunehmend zur »Überdiagnostik« und »Übertherapie«. Gemeint sind damit Eingriffe, die das Wohlergehen der Menschen nur verschlechtern: Es werden vermeintliche Leiden therapiert, die nie Beschwerden verursacht hätten.
Zum Beispiel hat die Hälfte aller 80-jährigen Männer Krebszellen in der Prostata. Die große Mehrzahl von ihnen stirbt jedoch nicht an, sondern mit dem Tumor. Trotzdem entdecken fragwürdige Tests immer häufiger immer frühere Krebsformen, von denen die Männer nie etwas gespürt hätten. Viele werden operiert und bestrahlt - mit Inkontinenz oder Impotenz als häufiger Nebenwirkung.
Mit ihren Leitlinien zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Leiden hat wiederum die Europäische Gesellschaft für Kardiologie vorgesorgt, dass die Patienten nicht ausgehen. Mit stetig abgesenkten Grenzwerten für Blutdruck und Cholesterin wurde die Mehrzahl der Erwachsenen zu Patienten gemacht. Tatsächlich gibt es kaum noch Gesunde, folgt man Europas Herzexperten: Unter ihren Grenzwerten, etwa einem Blutdruck von höchstens 140 zu 90 oder einem Cholesterinspiegel von 193 Milligramm pro Deziliter Blut, bleibt nur ein Viertel aller Erwachsenen. Unter den 50-Jährigen hätten demnach mehr als 90 Prozent ein erhöhtes Risiko, frühzeitig einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.
Im Extremfall ergeht es Patienten wie dem 80-jährigen Amerikaner, dessen Fall das renommierte New England Journal of Medicine aufgriff, um die Auswüchse des modernen Gesundheitssystems zu dokumentieren. Der Mann bemerkte eines Tages während der Gartenarbeit eine Schwellung in der Leiste. Der Hausarzt diagnostizierte einen Leistenbruch und riet zur Operation. Im Krankenhaus bemerkten die Ärzte Auffälligkeiten im EKG. Die Herzkranzgefäße waren offenbar verengt, er würde eine Bypass-Operation benötigen. Vor einem solchen Eingriff werden routinemäßig die Blutgefäße untersucht - die Halsschlagader war ebenfalls verengt, das musste vor der Herzoperation behoben werden. Dazu wurde die Arterie von innen ausgeschält, ein Routineeingriff.
Allerdings löste sich dabei ein kleines Blutgerinnsel, trieb zum Kopf und verursachte einen Schlaganfall. Der Mann war halbseitig gelähmt und konnte nicht sprechen. In der Reha erholte er sich immerhin so schnell, dass nach einem halben Jahr sein Herz operiert werden konnte und er seine Bypässe bekam.
Aus Sicht der Ökonomen im Krankenhaus war die Behandlung ein Erfolg. Und auch dem Patienten ging es ein Jahr, nachdem er die Beule in der Leiste bemerkt hatte, langsam besser. Seinen Leistenbruch hatten die Ärzte zwar noch nicht operiert, aber wozu auch: Er war ja jetzt nicht mehr so mobil.
Illustrationen: La Tigra